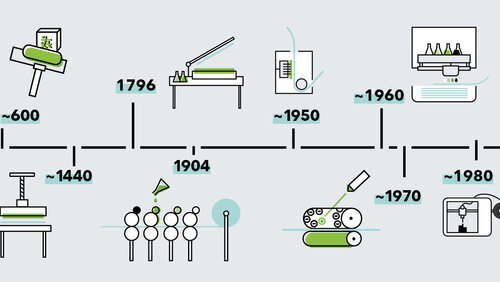Wo findet heute Qualitätsjournalismus statt? Auf Papier? Im Netz? Überall? Wir haben in der Medienlandschaft nach Antworten gesucht.
Natürlich ist das Quatsch: „Qualitätsjournalismus“. Als könne man das Produkt in verschiedenen Preisklassen kaufen. Einmal unabhängig, ausgewogen und wahrhaftig, und einmal so ganz ohne Prinzipien. Journalismus ist Journalismus – da braucht es kein Gütesiegel.
Aber der Begriff zeigt, was in der Medienindustrie in den vergangenen knapp 20 Jahren kaputtgegangen ist. Das ist ein bisschen so wie mit den Bäckereien. Seit da im Fenster steht: „Frisch gebacken“, kann man sicher sein, dass hier nichts mehr frisch gebacken wird, sondern nur noch aufgetaut und aufgewärmt.
Guter Journalismus – nur im Print möglich?
Der Begriff „Qualitätsjournalismus“ kam auf, als die Medienkrise zu wüten begann. Wir erinnern uns: Platzen der Dotcom-Blase, Anzeigenrückgang, weniger Werbeeinnahmen, Entlassungen, Zeitungssterben. „Qualitätsjournalismus“ wurde zum Kampfbegriff und Verkaufsargument, oft mit dem Hinweis aufs Printprodukt. Hermann Petz, der Verleger der Tiroler Tageszeitung, ließ sich in einem Interview sogar einmal zu der Aussage hinreißen: „Es gibt Qualitätsjournalismus nur in Verbindung mit bedrucktem Papier – und das aus belegbaren Gründen.“
Der Begriff „Qualitätsjournalismus“ hat bis heute Konjunktur und – wie Volker Lilienthal, Professor der Journalistik an der Universität Hamburg, einmal im Tagesspiegel formulierte – auch seine Berechtigung: „als Leitidee für ein anzustrebendes Ideal, als Motivation für den ambitionierten, den elaborierten, den besseren Journalismus, der sich nicht darin erschöpft, die Verlautbarungen anderer nur medial zu verstärken.“
Mittlerweile dürfte es aber kaum noch erfolgreiche Verleger geben, die glauben, guter Journalismus finde nur auf dem Papier statt. Zwar hat das Internet das Geschäftsmodell des Journalismus in eine Krise gestürzt. Es hat ihn aber auch bereichert. Es ermöglicht globale Recherchekollektive wie im Fall der „Panama Papers“ oder des „Daphne Projects“. Es verhilft kritischem Journalismus zu neuer Reichweite. Und es hat aus einem Blindflug ein Fliegen auf Sicht gemacht.
Nützlicher Algorithmus
Wenn Matthias Giordano morgens am Schreibtisch seine E-Mails abruft, wartet da ein Bericht aus dem Maschienenraum der Redaktion auf ihn. Jeden Tag stellt ein Analysetool aus den gesammelten Daten von www.welt.de einen Report mit blanken Traffic-Zahlen zusammen. Ein redaktionsinternes Messsystem macht aus diesen Daten dann einen sogenannten Artikel-Score. Dort sieht der leitende Redakteur des Welt-Ressorts „kmpkt“, wie sich die Artikel seines Teams über Technologie, Wissenschaft und Popkultur im Vergleich mit den Stücken der anderen Welt-Ressorts geschlagen haben.
Der Algorithmus misst unter anderem Reichweite, Social-Media-Performance und Verweildauer der Leser, vergibt entsprechend Punkte und erstellt dann ein Ranking. „Für uns ist das hilfreich. Wir sehen dann, wie effizient eine Geschichte war und vor allem, wo wir uns verbessern können“, so der 29-Jährige.
Klicken die Leser zu schnell weiter? Wünschen sie sich mehr Videos? Welche Themen interessieren sie? All das kann der Journalist aus den Daten ablesen und „an den entsprechenden Schrauben drehen“. Das Feedback ist direkt: Schon am nächsten Tag sieht das „kmpkt“-Team, was funktioniert. „Ein noch deutlicheres Bild zeigt die Auswertung des gesamten Monats, da so die Statistiken weniger durch einmalige Ausschläge nach oben oder unten verzerrt werden. Das ist sehr motivierend.“
Was Leser wirklich wollen
Nun ist das, was „funktioniert“, nicht automatisch guter Journalismus. Vor nicht allzu langer Zeit überschwemmte Clickbait à la „Du wirst nicht glauben, was dann geschah“ die sozialen Medien. Dahinter steckte meistens Müll, der die Leser enttäuschte. Aber die Inhalte erreichten Millionen Menschen. Ähnlich erfolgreich sind Mainstream-Nachrichtenseiten mit seichtem Content. Sex, Unfälle, Prominente? Klickt gut!
Wer jetzt ruft: „Ich lese nie Müll! Ich lese nur Auslands- und Wirtschaftsnachrichten!“, der sollte noch einmal in sich gehen und genau hinhören. Die meisten Menschen interessieren sich nicht für echte Nachrichten, würden das aber nie zugeben. Das ergab eine US-Studie des Reuters Institute for the Study of Journalism im Jahr 2014. „Fragt man die Leute, was sie wollen, sagen sie Gemüse. Beobachtet man sie still und leise, essen sie fast ausschließlich Süßigkeiten“, schrieb das US-Magazin The Atlantic damals.
Das Internet hält uns gnadenlos den Spiegel vor. Und wer immer wieder auf Müll klickt, bekommt mehr Müll serviert. Schließlich zeigen die Daten den Medienkonzernen: Müll kommt an. Mit Müll kann man Geld machen. Zumindest mittelfristig – denn nachhaltig ist das meist nicht. Gewisse Leserschichten wachen irgendwann auf und springen ab.
Matthias Giordano versteht die Daten über Nutzergewohnheiten deswegen nicht als Handlungsanweisung, sondern eher als Inspirationsquelle. „Wir sind heute nicht mehr ‚data-driven‘, sondern ‚data-informed‘“, sagt er mit einem Augenzwinkern. „Wir arbeiten schließlich weder an der Börse noch bei einer Bank. Wir machen Journalismus.“
Reichweite oder Qualität?
Aufgrund einer bis heute ausgeprägten Gratiskultur im Netz ist der Spagat zwischen Reichweite und Qualität nicht einfach. Qualität kostet Geld, und Reichweite macht Geld. Denn damals wie heute gilt: Je größer die Reichweite, desto mehr Geld lässt sich mit Werbung verdienen. Lokalmedien in Schweden wollen diesem Dilemma nun gemeinsam entkommen und setzen in Zukunft auf Paid Content.
Die Mediengruppen VK, Sörmlands Media, Hallpressen und Mittmedia haben 2017 gemeinsam Bezahlschranken eingeführt und wollen so online die Qualität im Lokaljournalismus sichern. Die Mitglieder des Netzwerks haben sich auf einen einheitlichen Digital-Abo-Preis und eine Art Flatrate geeinigt: Die zahlenden Abonnenten einer Zeitung dürfen kostenfrei die Inhalte aller anderen Zeitungen im „Plusnätverket“ (Plus-Netzwerk) lesen.
Auch die Zusammenarbeit auf redaktioneller Ebene soll im Netzwerk besser werden: So sollen die verantwortlichen Chefredakteure einfacher miteinander kommunizieren können und die Berichterstattung über Großveranstaltungen wie Wahlen und Sportereignisse gemeinsam geplant werden.
Die Longreads (über-)leben
Wer zu Beginn des digitalen Wandels um die Qualität im Journalismus bangte, bangte auch oft um lange, ausgeruhte Lesestücke. Würden Reportagen und Features im Netz überleben? Würden sie Leser finden, trotz kleiner Bildschirme, Häppchenkultur und sinkender Konzentrationsspanne? Heute lautet die Antwort: ja.
Schon 2016 untersuchten Forscher des Pew Research Center in Washington die Lesegewohnheiten von Smartphone-Nutzern. Das Ergebnis: Im Durchschnitt verbringen die User mehr Zeit mit sogenannten „Longreads“ als mit kurzen Stücken.
In Deutschland hat sich das Projekt LiesMich langen Texten verschrieben. Erfolgreich finanziert über Crowdfunding, stellt das Team täglich seine Lieblingsstücke aus deutschsprachigen Zeitungen und Magazinen auf www.liesmich.me vor und will so arbeitsintensiven, hintergründigen Texten eine zusätzliche Plattform geben. „Über ein Drittel unserer Besucher liest die Reportagen von LiesMich auf einem Tablet oder Smartphone – Tendenz steigend“, sagte LiesMich-Redakteur Laurence Thio im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, schob dann aber schnell nach: „Auch eine Wende zurück zum gedruckten Magazin ist denkbar“. Als Beispiel nennt er Langstrecke, das Longread-Magazin der SZ.
Print als Premiumprodukt
Print hat also durchaus noch seinen Platz in der Medienlandschaft. Auch Online-Journalist Matthias Giordano, der mit seinem Team auschließlich digitale Inhalte für die Website der Welt produziert, liest noch regelmäßig gedruckten Journalismus. Zeitunglesen bringe eine gewisse „Grundruhe“ mit sich, sagt er. „Da liest man auch mal konzentriert fünf bis sieben Artikel am Stück. Das ist online kaum zu schaffen. Dort bin ich viel sprunghafter, nervöser.“
Gut gemachter Print sei immer noch ein „Premiumprodukt“, so Giordano. Schöne Layouts. Große Bilder. Ungewöhnliche Schriften. „Man kann da ein Gefühl verkaufen.“ Und natürlich sei da noch der „natürliche Vorteil“: Print kann man auch dann noch lesen, wenn der Akku des Smartphones längst leer ist.
Text: Marten Hahn
Foto: Samuel Zeller/Unsplash